Bis ins 15. Jahrhundert hinein war in Deutschland das Brauen am heimischen Herd genauso selbstverständlich – und für den privaten Verbrauch auch rechtens – wie das Backen. Und es war Sache der Frauen, deren wichtigste Mitgift ein schöner, kupferner Braukessel war. Das Recht zur Bierherstellung in größeren Mengen stand vor allem den Städten zu. Sie regelten bereits ab dem 14. Jahrhundert in ihren Verordnungen Ausschank, Verkauf, Preise und sogar die Sperrstunde, „Bierglockenzeit“ genannt. Professionelle Sachverständige, „Bierkieser“, „Bierkoster“ oder „Bierherren“ überprüften im Auftrag des Magistrates die Bierqualität. In Köln überwachten sie beispielsweise auch den Hopfen- und Malzhandel sowie die städtischen Malzmühlen und waren befugt, bei Verstößen Strafen zu verhängen. Ihre Amtszeit betrug zwei Jahre und wurde mit jährlich 40 Goldgulden entlohnt. Auf dem Land durfte nur in weit von Städten entfernten Rittergütern oder Landschänken Bier gesiedet werden. Um die Städte und Rittergüter herum galt der Braubann, also das Brauverbot, im Umkreis der Brau- oder Biermeile deren Ausdehnung sich auf ungefähr 15 Kilometer belief und den lokalen Brauereien ein exklusives Absatzgebiet garantierte. Es versteht sich von selbst, dass die so privilegierten Bürger argwöhnisch das Umland beäugten und jeden Verstoß umgehend zur Anzeige brachten. Das Braurecht wurde pro Haushalt vergeben, aber nur die wohlhabenderen Bürger konnten die Kosten des Biersuds vorfinanzieren. Somit garantierten die Stadtmagistrate ihren besten Steuerzahlern mit dem Braurecht auch eine sichere Einnahmequelle. In Dresden beispielsweise kamen 1416 auf 228 Häuser 165 Braurechte, 1626 waren es 1950 Häuser mit 1264 Braurechten, wobei es sich vielfach um durch Erbschaften oder Verkäufe entstandene Bruchteile von Konzessionen handelte, von denen sich teilweise auch mehrere auf ein Haus verteilten. Einen wichtigen Beitrag zum Siegeszug des Bieres lieferten auch die starken Preisschwankungen des schon zu guten Zeiten mindestens dreimal so teuren Weines. Starke Qualitäts- und Quantitätsunterschiede in den Ernten machten das höfische Getränk wesentlich unberechenbarer für den Handel als den Gerstensaft.
Gebraut und ausgeschenkt wurde nach einem Losverfahren oder „in Reihe“ meist in zentralen Kommunbrauhäusern oder mehreren jeweils angemieteten Brauereien. Um sicherzustellen, dass es immer ein konstantes Bierangebot gab, losten die Magistrate die Brautage zwischen den Braurechtsbesitzern aus, oder sie kamen nach einer festgelegten Ordnung an die Reihe. Die Kommunbrauhäuser hatten mehrere Vorteile: Zu Beginn ihrer Einrichtung ab dem 14. Jahrhundert halfen sie vor allem, das Brandrisiko zu verringern, weil sich eine Feuerstelle besser kontrollieren ließ als mehrere. Natürlich unterlag auch die zentralisierte Nutzung durch die Bürger einer besseren und einfacheren Kontrolle. Mit der Zeit stellten die Städte eigene Braumeister ein, die für die Braubürger die Bierherstellung übernahmen. Das war ein wesentlicher Beitrag zur Qualitätssicherung, auch wenn die Konzessionsinhaber in der Regel auch weiterhin das Bier bei sich zu Hause vergären ließen. Unmittelbar nach dem Brauen wurde das in der Regel meist obergärige Braunbier, das keine lange Haltbarkeit besaß, auch ausgeschenkt. Dieses System wurde teils noch bis in die Mitte des 19 Jahrhunderts praktiziert, wobei die Braukessel sowie die Anzahl der wöchentlichen Sude immer größer wurden. In Bremen erstellten die Brauer aus einem Sud um 1450 etwa 1125 Liter, 50 Jahre später waren es bereits 2600 Liter und um 1650 schließlich 3200 Liter. Auch anderorts steigerte sich die Bierproduktion stetig, wie beispielsweise im belgischen Lier, wo um 1400 monatlich noch 4300 Liter, 74 Jahre später schon 9800 Liter und um 1600 schließlich 17 000 Liter gebraut wurden.
Nach und nach entwickelte sich eine professionelle Brauerschaft, die Braurechte von anderen Bürgern sowie die Kommunbrauhäuser pachtete. Ab und an wurden sich auch Genossenschaften gebildet, die das jeweilige städtische Brauhaus übernahmen, oder es erfolgten Geschäftsgründungen von Brauereien mit eigenen Anlagen. Interessant sind aus heutiger Sicht vor allem die Bestimmungen für die Lehrlinge. So mussten sie etwa in Dresden mindestens 15 Jahre alt sein und mit dem Vater oder einem Verwandten einen Bürgen haben, der für den Ausfall des Meisterlohns geradestand. Der Meister erhielt 10 Taler Lehrgeld, die gleiche Summe wurde nach Beendigung der Lehre nochmals fällig. Anschließend hatte der frischgebackene Geselle eine zweijährige Wanderschaft durch mindestens drei Länder zu absolvieren, um dortigen Gepflogenheiten seines Handwerks zu erlernen. Der Wochenlohn eines Gesellen betrug 1 Taler und 12 Groschen. Wollte der Geselle anschließend Meister werden, brauchte er einen Erbschein, Kauf- oder Pachtvertrag für eine Braustätte, musste einen Meistersud einbrauen und 36 Taler Gebühren entrichten.
Mit der Industrialisierung und dem Aufstieg des untergärigen Bieres (siehe -> Bierland Bayern) veränderte sich die Brauereistruktur Deutschlands maßgeblich. Aus Familienbetrieben wurden, ausgehend von Sachsen und Bayern, Aktiengesellschaften, die dank ihrer Fähigkeit, schnell neues Kapital aufzutreiben, die einzigen waren, die mit den raschen Technologiesprüngen und der zunehmenden Ausweitung der Handelswege Schritt halten konnten. Deswegen folgte ab der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Gründungswelle von Brauereien insbesondere in Berlin und im Ruhrgebiet, die Bier „nach bairischer Art“, also untergärig herstellten. Die Reichshauptstadt als politisches und finanzielles Zentrum erlebte vor allem den Aufstieg der Schultheiss-Brauerei, die 1842 gegründet und 1871 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Die Brauerei überschritt 1904 den Produktionsausstoß von einer Million Hektolitern, beschäftigte 2000 Arbeiter und Angestellte und nannte 537 Pferde, 533 Wagen und 65 Eisenbahn-Transportwaggons ihr Eigen. Damit zählte sie zu den 300 größten Firmen des Reiches und konnte ihren Aktionären eine Dividende von über 14% auszahlen.
In der preußischen Rheinprovinz und Westfalen schlug hingegen mit dem Ruhrgebiet in seinem Zentrum das industrielle Herz des Landes. Dort legte der Durst der Arbeiterschaft kräftig zu und lag um 1900 bei gut 100 Litern Bier pro Kopf und Jahr. In Bayern waren es zwar stolze 290 Liter, aber der anhaltende Bevölkerungszuwachs an der Ruhr machte die Pro-Kopf-Differenz locker wett. Im westfälischen Dortmund braute Heinrich Wenker in der väterlichen Traditionsbrauerei „Krone am Markt“ 1843 das erste untergärige Bier, das anfangs als „niggemod’sches Herrenpier“ verschrien war. Wenker hatte in München und Wien die Brauerausbildung absolviert und in seiner Heimatstadt anschließend mit den dort verfügbaren Rohstoffen einen neuen Bierstil etabliert. In den 1860er-Jahren gab es bereits neun „Bairische Bierbrauereien“ in der Stadt, für die der überseeische Exportmarkt ein wichtiges Standbein wurde. Aufgrund der dadurch bedingten längeren Transportwege brauten die Brauereien ihr Bier kräftiger ein – das „Dortmunder Exportbier“ war geboren und erhielt in den 1870er-Jahren seine heutige helle Färbung. Zu den ab 1871 in der Stadt gegründeten Aktienbrauereien gehörte auch die Dortmunder Union-Brauerei, die 1887 das Dortmunder Export in ihr Programm aufnahm und damit weltweiten Erfolg verzeichnen konnte. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg produzierte Dortmund mit seinen 19 Brauereien deutschlandweit das meiste Bier.
Die deutsche Brauwirtschaft entwickelte sich nach der Reichsgründung in kürzester Zeit zum bedeutendsten Bereich der Ernährungsindustrie und hatte 1906 daran einen Anteil von über 60%. In derselben Zeit setzte sich auch endgültig das untergärige Brauverfahren durch. Lagen 1870 ober- und untergärige Biere noch in etwa gleich auf, verließen 1912 zu über 90% untergärige Biere die deutschen Brauereien. Die Menge an verkaufsfertig produziertem Bier stieg von 30 auf über 70 Millionen Hektoliter an und das Deutsche Reich steigerte seine Steuereinnahmen aus der Bierwirtschaft von 40 auf 232 Millionen Mark, mehr als 3% seines Bruttosozialproduktes.
Nachdem das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in den Industrienationen von Prosperität und Aufschwung geprägt war, mussten die europäischen Brauer nach vielen Friedensjahrzehnten, in denen gerade die Brauindustrie gewaltige technologische und logistische Fortschritte gemacht hatte, 1914 den Auswirkungen der Kriegswirtschaft ins Auge blicken. Dies traf besonders die exportorientierten deutschen Brauereien hart, hatten sie doch in der Vergangenheit teils große Marktanteile in den USA und anderen Ländern erobert. Auch wenn die Vereinigten Staaten noch kein Feindesland waren, behinderte doch die britische Seeblockade den Handel und die Versorgung der Mittelmächte in gewaltigem Ausmaß.
Demzufolge hatte die Versorgung der Bevölkerung und der Soldaten die oberste Priorität im Deutschen Reich. Hopfengärten mussten Ackerland weichen und statt Braugerste standen nun Weizen und Roggen auf den Feldern. Die Brauer erhielten immer geringere Malzzuteilungen, was die Stammwürze des Bieres auf unter 3% sinken ließ. Zudem war es schwierig, Ersatz für die zum Kriegsdienst eingezogenen Mitarbeiter zu finden. Die Münchner Löwenbrauerei beispielsweise hatte vor dem Kriegsbeginn 783 Mitarbeiter. Im ersten Kriegsjahr mussten davon 344 an die Front, bis Kriegsende sogar 495. Für sie standen 118 Frauen „ihren Mann“ in der Brauerei.
Zu Kriegsende waren 10–15% der eingezogenen Mitarbeiter gefallen, weitere arbeitsunfähig oder zumindest nur eingeschränkt belastbar. Während sich die Deutschen noch Gedanken machten, wie sie die Reparationsforderungen der Siegermächte erfüllen sollten, stellte die steigende Geldentwertung, die in der Hyperinflation von 1923 gipfelte, die Brauer vor erneute, existentielle Probleme. Erst ab 1921 es ihnen wieder möglich, Bier mit 12% Stammwürze zu brauen, nun kostete die Maß auf einmal 98,6 Milliarden Reichsmark und die Brauereien hatten 18-stellige Bilanzen in den Büchern stehen. Erst 1927 hatte sich die Brauwirtschaft von diesem ökonomischen Desaster wieder erholt, die alten Produktionsrekorde der Vorkriegszeit lagen jedoch noch in weiter Ferne. Hatten die deutschen Brauereien 1913 noch 940 000 Hektoliter exportiert, waren es 1933 gerade einmal 238 000.
Auch im Zweiten Weltkrieg mussten die Brauereien gut ein Drittel ihrer Belegschaft an die Wehrmacht abgeben, von denen ca. 10% nicht wieder zurückkehrten. Aufgrund von Rohstoffmangel und Änderungen in der Landwirtschaft wurde schon bald nach Kriegsbeginn die Versorgung der Brauereien reduziert. Schon 1942 hatte das deutsche Bier in der Regel nur noch 3,5% Stammwürze und damit einen Alkoholgehalt, der zwischen 1% und 2% lag.
Während die Brauereien selbst im Ersten Weltkrieg und in der nachfolgenden Inflation und Weltwirtschaftskrise kaum in Mitleidenschaft gezogen wurden, lag ein Großteil von ihnen 1945 in Trümmern. Noch funktionierendes Gerät wurde zudem in der östlichen Besatzungszone als Reparationsgut demontiert und in die Sowjetunion transportiert. In den ersten Nachkriegsjahren durfte überhaupt nicht gebraut werden, dann nur für die Angehörigen der Besatzungstruppen. Die ersten Biere für den deutschen Markt hatten 1948 nur 1,8% Stammwürze. Erst nach der Währungsreform normalisierte sich in den Westzonen der Biermarkt wieder und ab 1949 konnte wieder „normales“ Bier mit 12% Stammwürze gesotten werden. Der Ausstoß betrug 1949/50 ca. 16,7 Millionen, im nächsten Braujahr sogar 21,8 Millionen Hektoliter, wovon bereits wieder 340 000 Hektoliter exportiert wurden – mehr als 1933! Der Bierdurst der Bevölkerung erholte sich allerdings nur langsam. Tranken die Westdeutschen 1938 durchschnittlich noch 70 Liter Bier pro Kopf und Jahr, waren es 1951 nur noch 47 Liter, allerdings mit steigender Tendenz. Um die Wirtschaft wieder an ein Friedensniveau heranzuführen, verfügten die Alliierten zudem einen festgesetzten Bierpreis, der 1950 bei 78 Pfennig für eine Maß Dunkles und 80 Pfennig für eine Maß Helles lag. Dafür musste ein Bauer eineinhalb Stunden arbeiten, ein Bauarbeiter 30 Minuten.
Autor: Markus Raupach
Fotograf, Journalist, Bier- und Edelbrandsommelier
Ausgezeichnet mit der Goldenen Bieridee 2015
copyright © Bier-Deluxe GmbH





 Bier
Bier  Teilen
Teilen 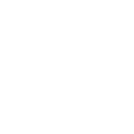 Sale
Sale 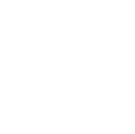 Newsletter
Newsletter